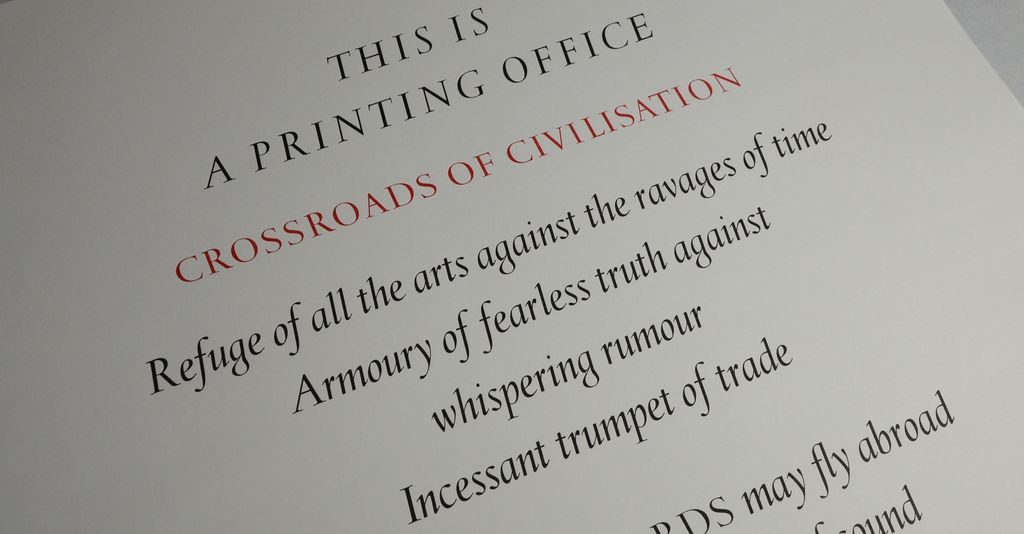Der Stall: wo Liebe und Wahrheit ein Zuhause finden
Wenn ich als Kind meine Großeltern besuchte, war mein größtes Glück der Moment, in dem mein Großvater mich mitnahm in seine alte Werkstatt. Er war Klempner und Elektriker gewesen. Ich muss noch sehr klein gewesen sein, als er mich das erste Mal dorthin mitnahm. Er war ein kleiner Mann und sein Gesicht ist das einer schwarzweiß Fotografie. Runzlig, alt und mit einer Brille, die viel zu groß ist für den hageren Kopf. An sein Gesicht von damals kann ich mich nicht im Detail erinnern – aber die Werkstatt sehe ich heute noch vor mir, obwohl sie schon seit vielen Jahren abgerissen ist. Dort steht jetzt ein Supermarkt und ein Seniorenheim. In meiner Erinnerung ist die alte Werkstatt ein Holzschuppen hinter dem großen Haus und unter einem mächtigen Nussbaum. Dunkelbraun die Lattung und über der Tür links, gleich unter dem Dachvorsprung ein kleiner Haken für den Schlüssel. Es war einer dieser schönen alten Schnörkelschlüssel mit Bart. Ich konnte da nicht hinauf reichen, aber mein Großvater nahm den Schlüssel vom Haken und öffnete damit die Tür. Diesen Blick hinein in den kleinen Raum mit seinem riesigen Tisch in der Mitte liebe ich noch heute. Die Luft flirrend von Staub und Licht, das sich seinen Weg bahnte von dem großen Fenster links direkt auf den Arbeitstisch. Die nach Süden gerichtete Fensterfront nahm fast die ganze Wandfläche ein und war zusammengefügt aus einer Unzahl von vielleicht handtellergroßen, quadratischen Glasscheiben, die mit Metallstegen verbunden waren. Heute noch ist diese Art Fenster für mich der Inbegriff eines Werkstattfensters.

Der Tisch war voller Werkzeug und Gerät. Zangen, Hämmer, Drahtrollen, Blechscheren. Und rechts vom Tisch an der Wand, die dem Fenster mit den vielen quadratischen Scheiben gegenüber lag, das stand die Maschine. Ehrfurchtgebietend. Heute würde ich sie auf einige hundert Kilo Gußeisen schätzen. Damals empfand ich sie schlicht als groß und unvorstellbar schwer und sie hatte einen geschwungenen Hebel, der von Jahren der Arbeit blank gewetzt war. Sie hatte eine magische Anziehungskraft auf mich, und obwohl ich auch Werkzeug immer schon faszinierend fand: sie stahl allem die Schau. Es war nicht nötig, ihn zu fragen oder flehentlich anzusehen. Wenigstens später nicht. Wir hatten unser Ritual: Immer griff er lächelnd zur Blechschere, schnitt von einem Rest Kupferblech ein Stück ab und reichte es mir mit der Mahnung „Paß aber auf, dass du dir die Finger nicht klemmst!“ Und dann durfte ich den Hebel bewegen und allein durch mich setzte sich die ganze riesige Maschine in Bewegung, gehorchte meiner winzigen Hand und bog das Stückchen Blech rund. Wir wohnten weit weg und ich kam nur in den Ferien zu meinen Großeltern, aber ich wollte jedesmal in die alte Werkstatt. In der neuen arbeitete der Onkel und es roch streng nach Kollophonium. Aber in der alten Werkstatt, da stand die Biegemaschine, und mein Opa würde mir ein Stück Blech geben und ich würde es biegen dürfen.

15. Juli 2016 
9. August 2016 
2. September 2016 
6. September 2016 
13. September 2016 
30. September 2016 
30. September 2016 
24. Oktober 2016 
16. November 2016 
23. November 2016 
9. Dezember 2016 
14. Januar 2017 
31. März 2017
Ich liebte diese Werkstatt, in deren Luft die Staubkörnchen silbern tanzten. Wenn ich nicht in einer Werkstatt sein konnte, dann war ich auch mit einem Stall zufrieden. Am liebsten bei Pferden, wo es die nicht gab, waren Kühe auch in Ordnung. Einer meiner schönsten Momente war der, als ich mir meine eigene Werkstatt, mein Atelier einrichten konnte. Über die Jahre ist sie größer geworden, ich habe sie zwei Mal umgezogen und ihr nach dem letzten Umzug ihren neuen Namen gegeben: The Fork and Broom Press. Seit 2017 ist sie in einem ehemaligen Kuhstall untergebracht. Für das Kind, das ich einmmal war, ist das eine ganz wundervolle Fügung: eine Werkstatt in einem Stall.